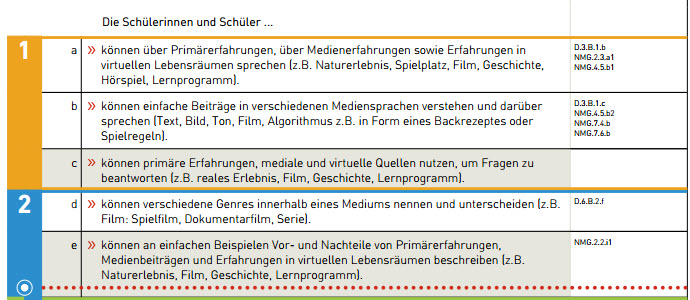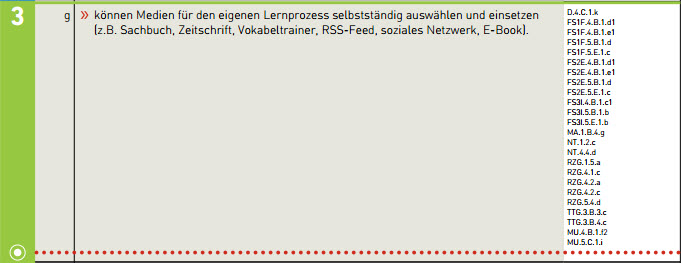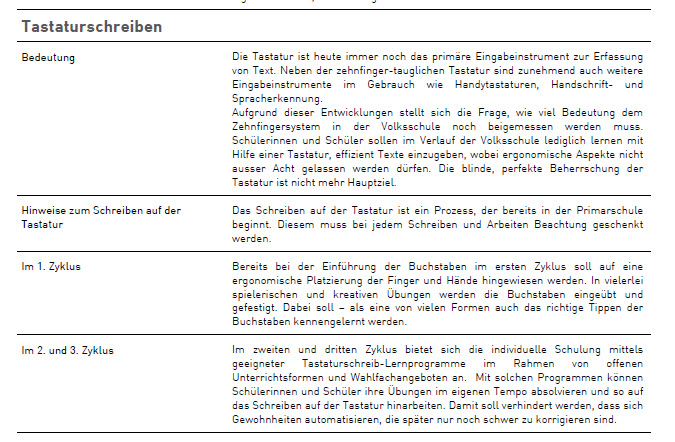Ist die Medienpädagogik zu stark auf Medienkritik fixiert? Das ist der Tenor eines Artikels von Philippe Weber und Andreas Pfister in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom 25. Juli 2013. Dies sind ganz neue Prügel, welche die Medienpädagogik einstecken muss. Bisher war es gerade umgekehrt: Manfred Spitzer und andere medienkritische Autoren warfen unserer Disziplin einen naiven und verharmlosenden Blick auf die Gefahren der Medien vor. Nur zur Erinnerung ein einschlägiges Zitat aus Spitzers Buch zur „Digitalen Demenz“:
„Aber Herr Spitzer, jetzt übertreiben Sie wirklich maßlos!“, höre ich Medienpädagogen (die von den Medien ja leben und sich aus genau diesem Grund nicht kritisch äußern), Vertreter der freiwilligen Selbstkontrolle und der Medien selbst schon sagen. Das ist zu erwarten. Traurig und aus meiner Sicht viel gefährlicher ist, dass sogar Kirchenvertreter, Politiker, das Gesundheitsministerium, das Bildungs- und Forschungsministerium,die Bundeszentrale für politische Bildung und die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Bundestags in das Hohelied auf die digitalenMedien völlig kritiklos einstimmen (S. 26).
Nun aber attakieren die zwei Gymnasiallehrer aus Zug die Medienpädagogik von der anderen Seite:
„Mit missionarischem Eifer ausgerückte Aufklärer und Medienlehrer, gesandt, um angeblich naive Jugendliche vor den Gefahren des Internets zu warnen, sehen sich heute konfrontiert mit einer neuen Situation: Kritik an den Medien ist längst zu einem Allgemeinplatz geworden – auch für Teenager.“
Wan an dem NZZ-Artikel ärgerlich ist, hängt mit dem Verfahren zusammen, das die Autoren anwenden: Erst bauen sie einen Popanz „Medienpädagogik“ auf, dem sie eine naive Form von „missionarischen Eifer“ unterstellen, um dann umso härter auf ihr Konstrukt einzuprügeln. Doch es ist ja keineswegs die Disziplin der Medienpädagogik, welche mit einem naiven Begriff von Mediengefahren hantiert. Vielmehr sind es Mediziner und Neuropsychologen wie Spitzer, sowie in der Schweiz die neue Zielsetzungen suchende Organisation Pro Juventute oder die Suchtprävention betreibenden Fachleute aus der Polizei, welche auf diese Weise Medienaufklärung betreiben.
Wenn die beiden Autoren dagegen von einer fundierten Medienkritik Einsicht sowohl in die Konstruiertheit der Medien als auch in die Relevanz dieser Konstrukte verlangen, so ist dies eine Position, welche zu den Grundüberlegungen einer Medienbildung gehört. Die Medienpädagogik versteht sich seit ihrem Beginn in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts denn auch nicht als Fundamentalkritik, sondern als Fürsprache für die Medien als Ressource für eine zeitgemässe Erziehung und Bildung – was ja Autoren wie Spitzer so auf die Palme gebracht hat. Schliesslich kann man aus einer medienpädagogischen Perspektive nur zustimmen, wenn die beiden Autoren in der NZZ festhalten: „Je gründlicher die Kritik, desto höher die Einsicht in die Relevanz. Medienkritik ist eine notwendige Voraussetzung, nicht um über Medien zu schimpfen, sondern um Leistungen und Qualität von Medien überhaupt erst wahrnehmen zu können.“
So könnte man den Bericht der NZZ als Sturm im Wasserglas bezeichnen, der hilft das publizistische Sommerloch zu füllen. Doch was ich problematisch finde, das ist die darin ausgesprochene Tendenz, Medienpädagogik auf Medienkritik zu verkürzen. Bereiche wie die Mediendidaktik, wo aufgezeigt wird, wie produktiv mit Medien im Unterricht gearbeitet werden kann, werden nicht erwähnt. Aber auch die Aufgabe, Studierenden in der pädagogischen Ausbildung Wissen zur Mediensozialisation oder grundlegendes Wissen aus den Medienwissenschaften zu vermitteln, wird ausgeblendet. Überall werden hier die Medien als zentrale Ressource für das Leben im 21. Jahrhundert betrachtet – und nicht unter der verkürzenden Formel: Medienpädagogik = (naive) Medienkritik.
Zum Schluss muss aber auch eine Lanze für die Medienkritik gebrochen werden: All die Vorgänge um die grossflächige Datenspionage, die in den letzten Wochen aufgeflogen sind, legen es auch aus aktuellem Anlass nahe, nicht einfach an gutwillige Medien zu glauben, die den heutigen Jugendlichen und Erwachsenen lediglich das Leben erleichtern wollen und Spass und Unterhaltung verschaffen. Je mehr das Internet durch kommerzielle und politische Interessen bestimmt wird, umso wichtiger werden hier auch medienkritische Einsichten. Studierende der PH Zürich haben in einer noch unveröffentlichten Untersuchung die Richtung angegeben, die sie für solche Aktivitäten wichtig finden. Sie wollen den Schülerinnen und Schülern durch Hinweise auf Gefahren der Medien keineswegs den Umgang mit Medien vermiesen. Vielmehr möchten sie diese durch medienkritische Aktivitäten „immunisieren“ und sie darin zu unterstützen, Medien als produktive Ressourcen in Schule und Freizeit medienkompetent zu nutzen. Das hat nun aber rein gar nichts damit zu tun, dass Medien „zum Abschuss“ freigegeben werden sollen,so wie es die beiden Autoren der Medienpädagogik pauschalisierend unterstellen.